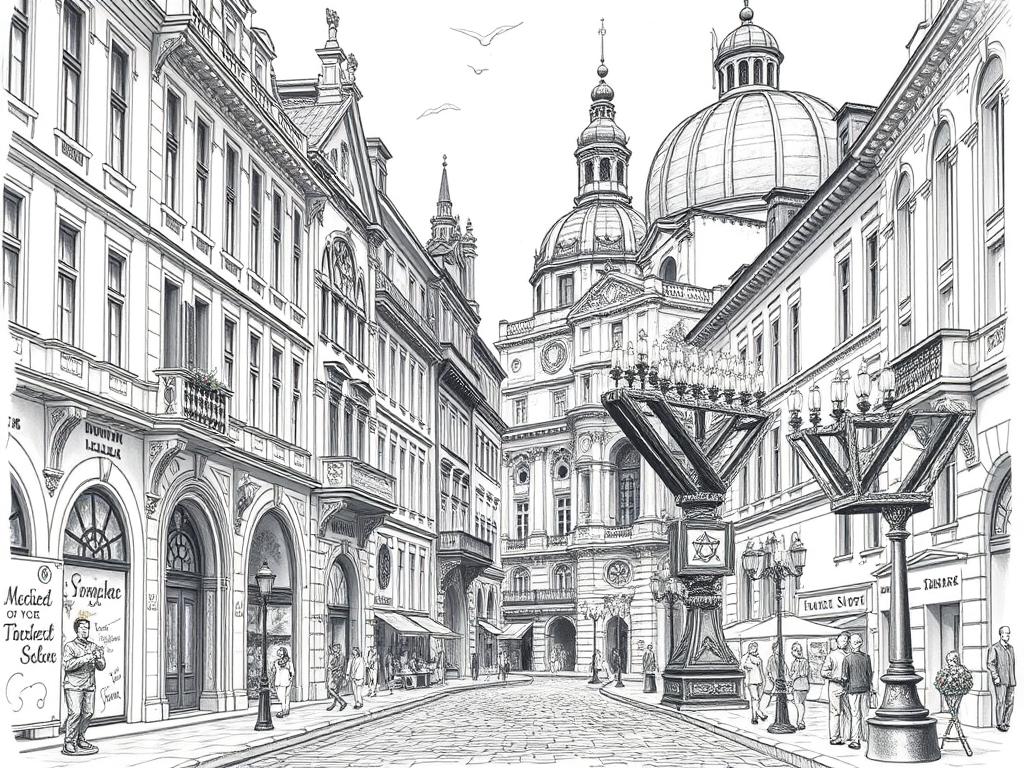Die Jüdische Geschichte Wien ist von tiefgreifender Bedeutung und beeindruckender Vielfalt geprägt, die im 12. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Wien stellt eine der ältesten jüdischen Besiedlungen in Österreich dar und hat über die Jahrhunderte hinweg sowohl florierende Phasen als auch düstere Zeiten durchlebt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte die jüdische Gemeinde Wien fast 200.000 Mitglieder, heute sind es weniger als 10.000.
Indem wir einen detaillierten Blick auf die jüdische Geschichte Wien werfen, erkennen wir die bedeutenden Ereignisse, die diese Gemeinschaft geprägt haben – von den Ausweisungen im 15. und 17. Jahrhundert über die Zerstörung der Synagogen in Wien während des Nationalsozialismus bis hin zur heutigen vielseitigen und lebendigen Kultur. Diese wechselvolle Geschichte zeigt, wie tief verwurzelt die jüdische Gemeinde Wien in das historische und kulturelle Gefüge der Stadt eingebettet ist.
Besondere Erwähnung verdienen bedeutende Persönlichkeiten jüdischer Herkunft wie Viktor Frankl und Sigmund Freud, deren wissenschaftliche Beiträge die medizinische und psychologische Welt nachhaltig beeinflusst haben. Die Synagogen in Wien, einst Symbole des blühenden jüdischen Lebens, stehen heute als berührende Erinnerungsorte und Mahnmale. Der Erhalt und die Pflege dieser Stätten sind fundamentaler Bestandteil jüdischer Identität und des kulturellen Erbes der Stadt.
Entdecken Sie die vielschichtige Entwicklung und den bedeutenden Einfluss der jüdischen Gemeinschaft in Wien, die eine bemerkenswerte Geschichte von Resilienz und kulturellem Reichtum erzählt.
Frühzeit der jüdischen Gemeinde in Wien
Die Erste Erwähnungen im Mittelalter von jüdischem Leben in Wien reicht zurück bis ins Jahr 1194, als ein jüdischer Mann namens Schlom dokumentiert wurde. Diese frühe Präsenz ist Teil eines reichhaltigen historischen Mosaiks, das die jüdische Geschichte in Österreich seit der Römerzeit prägt. Bereits am Anfang des Mittelalters zeugt die Raffelstettener Zollordnung der Jahre 903-906 von frühen Handelstätigkeiten jüdischer Kaufleute in der Region.
Im Laufe des Mittelalters entstanden in Wien zwei bedeutsame Judenviertel: das im heutigen 1. Bezirk am Judenplatz und ein größeres Viertel im früheren 17. Jahrhundert in der Leopoldstadt. Trotz mehrfacher Verfolgungen blühten in diesen Gemeinschaften bedeutende jüdische Gelehrte und Rabbiner auf. Eines der nachhaltigsten Zeugnisse dieser Zeit ist der älteste erhaltene Grabstein auf dem jüdischen Friedhof von Rossau, der aus dem Jahr 1582 stammt.

Die jüdische Gemeinde in Wien erhielt im Jahr 1244 ein herzogliches Privileg, das die rechtlichen Grundlagen ihrer Existenz sicherte. Dies ermöglichte, dass im Laufe des 14. Jahrhunderts Jeschiwot im österreichischen Raum entstanden, was die umfassende Bildungs- und Religionspraktiken dieser mittelalterlichen jüdischen Gemeinschaft belegt. Eine signifikante Herausforderung für die Gemeinde war jedoch die Vertreibung unter Kaiser Leopold I. im Jahr 1669, die zu einer massiven Beeinträchtigung der jüdischen Präsenz in Wien führte.
Im frühen 16. Jahrhundert entwickelte sich eine bedeutende jüdische Ansiedlung in der Gegend von Rossau, auch bekannt als „Oberer Werd“. Trotz der späteren Widrigkeiten unter Kaiser Leopold I. blieb die jüdische Gemeinde bis auf wenige Unterbrechungen in der Lage, ihre Gemeinschaftsstrukturen zu bewahren. Diese Erste Erwähnungen im Mittelalter markieren den Beginn einer komplexen und trotz vieler Herausforderungen blühenden jüdischen Geschichte in Wien.
Blütezeit des jüdischen Lebens im 19. Jahrhundert
Das 19. Jahrhundert markierte eine Ära der kulturellen und gesellschaftlichen Blüte für die Juden Wiens. Diese Zeit wurde durch wegweisende Ereignisse und Schlüsselpersonen beeinflusst, die die Kulturelle Highlights und Integration der jüdischen Gemeinschaft prägten. Der Kaiser Franz Joseph I. und das Staatsgrundgesetz von 1867 spielten eine entscheidende Rolle bei der Emanzipation der Juden Wien, was zur Ankunft einer steigenden Anzahl jüdischer Menschen führte.
Die jüdische Bevölkerung Wiens wuchs rapide: 1848 gab es wenige Tausende, während sie bis 1898 auf etwa 100.000 anstieg. Diese dynamische Zunahme förderte eine bedeutende jüdische Kultur Wien im intellektuellen, wissenschaftlichen und künstlerischen Bereich.
Diese Periode zeugte von der Gründung herausragender Einrichtungen wie der Universität Wien, die viele jüdische Wissenschaftler anzog und das allgemeine Bildungsniveau der Stadt erhöhte. Werke von Sigmund Freud und Theodor Herzl trugen wesentlich zur kulturellen Landschaft bei und erhoben Wien zum intellektuellen Zentrum Europas.
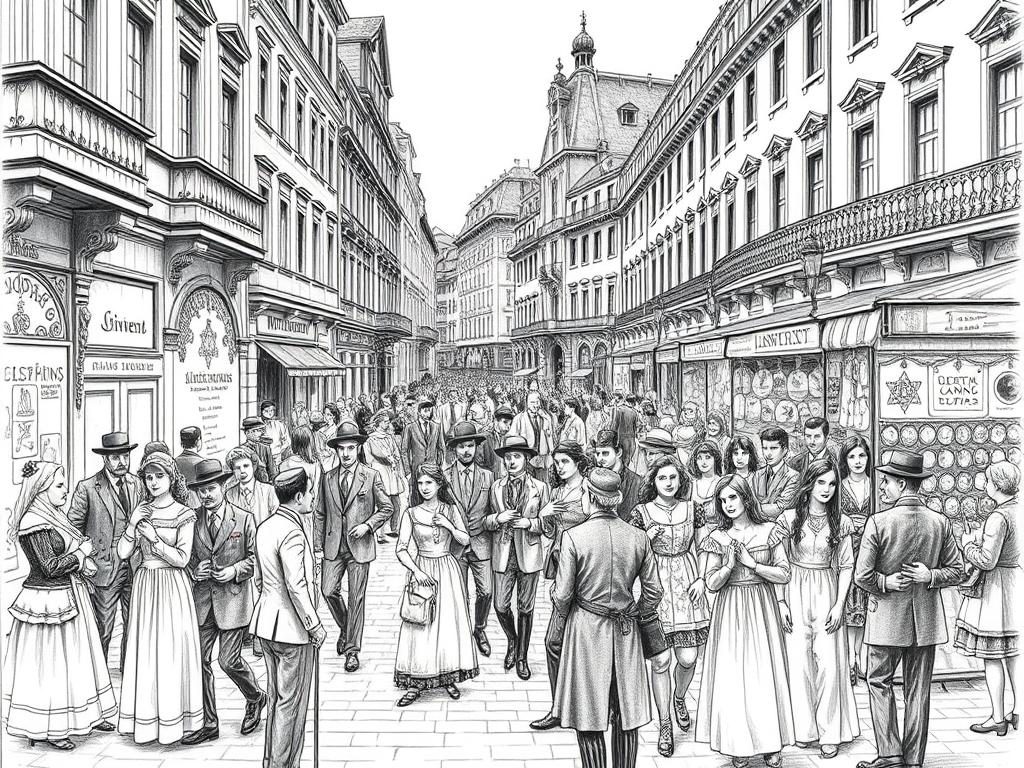
Ein weiteres Beispiel für die dynamische jüdische Kultur Wien war der jüdische Sportverein Hakoah, der 1925 den österreichischen Meistertitel im Fußball gewann. Der Verein besteht bis heute und hat knapp 1.000 Mitglieder, darunter auch viele zugewanderte Juden aus Osteuropa.
Kulturelle Highlights und Integration wurden ebenfalls durch prominente Künstler und Musiker wie Gustav Mahler und Arnold Schönberg geprägt. Ihre Werke hinterließen dauerhafte Eindrücke in der Wiener Musik- und Kulturszene. Diese Epoche zeigte eindrucksvoll, wie weit die Integration der jüdischen Gemeinschaft in die kulturelle und gesellschaftliche Struktur Wiens fortgeschritten war.
Antisemitismus im Wien des 20. Jahrhunderts
Die dramatischen und tragischen Auswirkungen des Antisemitismus im Wien des 20. Jahrhunderts sind ein düsteres Kapitel der Geschichte. Besonders zwischen 1938 und 1945 wurde die jüdische Bevölkerung fast vollständig aus Wien vertrieben oder ermordet. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Wien ein bedeutendes Zentrum jüdischen Lebens und Kultur. Die politischen und gesellschaftlichen Strömungen jener Zeit brachten jedoch eine erhebliche Verschlechterung der Lebensbedingungen für die jüdische Bevölkerung mit sich.
Im Rahmen eines Studienprojekts der Universität Udine, Italien, wurden 2018 verschiedene Aspekte des jüdischen Lebens in Wien untersucht. Die Teilnehmer, darunter 13 Studentinnen, 2 Sprachdozierende und 2 Lehrkräfte, führten eine 7-tägige Exkursion durch, um die Auswirkungen des Holocaust zu erfassen. Die Studienreise und zwei Konferenzzyklen mit je drei Abendveranstaltungen boten tiefgehende Einsichten in die historischen und kulturellen Entwicklungen.
Wien diente als wichtiger Kontext für das Verständnis der politischen und gesellschaftlichen Strömungen des 20. Jahrhunderts, einschließlich des Antisemitismus. Besonders aufschlussreich war die Analyse des Films „Eine blass blaue Frauenschrift“, der die soziale und psychologische Landschaft Österreichs im Jahr 1936 porträtierte. Adornos Aussage zur Absurdität des Poesie-Schreibens nach Auschwitz verdeutlichte die kulturelle Antwort auf die traumatischen Ereignisse der Zeit.
Die jüngsten Ereignisse, wie der antisemitische Angriff im jüdischen Viertel Wiens am 2. November 2020, unterstreichen die anhaltenden Herausforderungen der jüdischen Gemeinschaft in Wien. Diese Zwischenfälle haben gezeigt, dass die politische und gesellschaftliche Strömungen erneut zu Antisemitismus führen können, insbesondere im Zusammenhang mit aktuellen geopolitischen Konflikten und Krisen wie dem Russland-Ukraine-Konflikt und der COVID-19-Pandemie.
Mitten in dieser turbulenten Zeit rückte Wien erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit, sowohl historisch als auch aktuell. Die jüdische Gemeinschaft in Wien lebt heute im Schatten dieser Vergangenheit, kämpft aber weiterhin für Anerkennung und Sicherheit in einer sich stetig wandelnden gesellschaftlichen Landschaft.
Das jüdische Leben nach dem Zweiten Weltkrieg
Trotz der schwerwiegenden Verluste und Zerstörungen, die die jüdische Gemeinde in Wien während des Zweiten Weltkriegs erlitten hatte, begann nach 1945 der Wiederaufbau der Gemeinde. Dies war ein mühsamer Prozess, der jedoch von starken Überlebenswillen und der Entschlossenheit, jüdisches Leben in Wien wiederzubeleben, geprägt war.
Ein entscheidender Schritt im Wiederaufbau war die Gründung neuer Synagogen, Schulen und sozialer Einrichtungen. Die jüdische Schule Wien spielte dabei eine zentrale Rolle und war eine der ersten Bildungseinrichtungen, die wieder eröffnet wurden. Diese Einrichtungen trugen wesentlich zur jüdischen Wiederbelebung in Wien bei und halfen, eine neue Generation jüdischer Kinder und Jugendlicher in einem wiedererstarkten jüdischen Umfeld großzuziehen.
Nach 1945 bestand der Wiederaufbau der Gemeinde nicht nur aus baulichen Maßnahmen, sondern auch aus der Wiederherstellung kultureller und sozialer Strukturen. Trotz der entsetzlichen Erfahrungen des Holocaust setzten sich die Überlebenden für einen Neuanfang ein. Es wurden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, religiöse Zeremonien und soziale Projekte ins Leben gerufen, um das jüdische Leben wieder zu fördern und die Gemeinschaft zu stärken.
Heute leben mehr als 10.000 Juden in der Leopoldstadt, und dieser Bezirk hat eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung der jüdischen Bildungseinrichtungen und in der gesamten Gemeindearbeit gespielt. Dank der gemeinsamen Anstrengungen ist der Wiederaufbau der Gemeinde ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie stark der Wille zur Erhaltung von Tradition und Kultur sein kann, selbst nach den dunkelsten Zeiten.
Gedenkstätten und Erinnerungsorte in Wien
Wien bietet eine Vielzahl bedeutender Gedenkstätten, die an die jüdische Geschichte und das Schicksal der jüdischen Bevölkerung erinnern. Ein herausragender Ort ist das Jüdisches Museum Wien, das die Geschichte und Kultur der jüdischen Bevölkerung Wiens dokumentiert. 2013 wurde die Dauerausstellung „Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute“ eröffnet, die zahlreiche Aspekte des jüdischen Lebens bis zur Gegenwart zeigt.
Zu den wichtigsten Gedenkstätten zählen auch diverse Friedhöfe und das von Rachel Whiteread geschaffene Mahnmal auf dem Judenplatz. Das Mahnmal, das am 25. Oktober 2000 enthüllt wurde, erinnert an mehr als 65.000 österreichische Jüdinnen und Juden, die zwischen 1938 und 1945 vom NS-Regime ermordet wurden. Der Entwurf des Mahnmals wurde 1996 unter neun eingereichten Vorschlägen ausgewählt und es ist seitdem ein zentraler Erinnerungsort in der Stadt.
Eine weitere bedeutende Gedenkstätte ist die Shoah-Namensmauern-Gedenkstätte, die an circa 65.000 jüdische Opfer der Shoah aus Österreich erinnert. Das Denkmal, bestehend aus rund 160 oval angeordneten Steintafeln, wurde im November 2021 offiziell eröffnet. Die Projektkosten betrugen etwa 5,3 Millionen Euro, finanziert durch Bund, Bundesländer und Spenden.
Ebenso bemerkenswert ist das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW). 1963 gegründet und seit 1983 eine Stiftung, archiviert und wertet es thematisch relevante Quellen im Bereich Widerstand, Verfolgung und Holocaust aus. Seit 1992 entsendet der Verein Gedenkdienst Freiwillige in Länder mit Verbrechen des Nationalsozialismus, um dort an die Opfer zu erinnern und aufzuklären.
Auch das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) und das Jüdische Institut für Erwachsenenbildung spielen zentrale Rollen in der Erinnerungsarbeit und der Förderung des Dialogs zwischen Juden und Nicht-Juden.
Jüdische Feste und Traditionen in Wien
Die jüdische Gemeinde in Wien pflegt eine reiche Tradition religiöser Festlichkeiten, die tief in ihrer Geschichte verwurzelt ist. Diese religiösen Feiern spiegeln nicht nur den kulturellen Reichtum der Gemeinde wider, sondern tragen auch zur Erhaltung und Weitergabe jüdischer Traditionen bei.
Ein zentrales Merkmal jüdischer Feiern sind die kulinarischen Spezialitäten, die jede Festlichkeit begleiten. Von den süßen Hamantaschen zu Purim bis zu den herzhaften Latkes zu Chanukka steht die Vielfalt der jüdischen Küche im Mittelpunkt jeder Feier.
Besonders bemerkenswert ist das Projekt #DiscoverJewishCulture, das darauf abzielt, jüdisches Leben und Kultur in Wien und Österreich einer breiteren, insbesondere jüngeren Zielgruppe zugänglich zu machen. Über Social Media Plattformen wie Instagram und TikTok werden Inhalte rund um jüdische Feste, kulinarische Traditionen sowie historisch bedeutende Orte und Persönlichkeiten verbreitet. Dies unterstreicht den Schwerpunkt auf die digitale Generation.
Der Bedarf an Aufklärung über jüdische Kultur und Geschichte wird durch den Hintergrund eines wachsenden Antisemitismus in der Gesellschaft noch verstärkt. Dieses Projekt arbeitet eng mit Partnerorganisationen wie den Jüdischen Österreichischen Hochschüler:innen (JÖH) und der IKG-Jugend zusammen, um authentische und vielfältige Perspektiven zu bieten.
Ein Beispiel für die Bedeutung jüdischer Traditionen in Wien ist der Feiertag Purim. An diesem Tag feiert die Gemeinde mit der Lesung der Esther-Rolle, einer angeregten Feststimmung und speziellen Bräuchen wie dem Verzehr von Hamantaschen. Die größte Esther-Rolle im jüdischen Museum in Wien stammt aus dem Jahr 1844 und stellt ein bedeutsames historisches Artefakt dar. Die Feierlichkeiten beinhalten auch das traditionelle ‚Megillah-Klopfen‘, bei dem lautes Getöse gemacht wird, um den Namen Hamans zu übertönen.
Religiöse Feiern sind ein integraler Bestandteil des jüdischen Lebens in Wien und helfen dabei, die Traditionen lebendig zu halten und der Gemeinschaft ein Gefühl von Zusammengehörigkeit zu verleihen. Durch Initiativen wie #DiscoverJewishCulture wird sichergestellt, dass diese reichhaltige Kultur auch zukünftigen Generationen erhalten bleibt.
Die heutige jüdische Gemeinschaft in Wien
Die jüdische Gemeinschaft in Wien hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich gewandelt. Heute zählt die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Wien knapp 8.000 Mitglieder, was im Vergleich zu den 185.000 Mitgliedern vor dem „Anschluss Österreichs“ an das Deutsche Reich im März 1938 deutlich kleiner ist. Dennoch bleibt die Gemeinde aktiv und engagiert sich intensiv am zivilgesellschaftlichen Leben der Stadt.
Wien beherbergt insgesamt etwa 12.000 Jüdinnen und Juden, darunter viele, die nicht Mitglieder der IKG sind. Demografische Entwicklungen spielen hierbei eine wichtige Rolle, indem sie die Veränderungen und Herausforderungen der heutigen jüdischen Bevölkerung widerspiegeln.
Ein signifikanter Teil des Engagements der jüdischen Gemeinschaft liegt im Bereich Bildung und Kultur. Die Gemeinde betreibt mehrere Schulen, darunter das renommierte Gymnasium Zwi Perez Chajes, und unterhält kulturelle Einrichtungen wie das Jüdische Museum Wien. Diese Institutionen sind nicht nur für die Mitglieder der Gemeinde selbst von Bedeutung, sondern leisten auch wertvolle Beiträge zur breiten kulturellen Landschaft Wiens.
Seit 2013 ist die IKG Wien durch die Fusion mit der IKG Graz zudem für die Bundesländer Steiermark, Kärnten und Südburgenland zuständig. Dies zeigt, wie sich demografische Entwicklungen auf die Organisationsstruktur der jüdischen Führung in Wien und darüber hinaus auswirken.
Die heutige jüdische Gemeinde ist somit eine lebendige und vielfältige Gemeinschaft, die trotz ihrer reduzierten Größe nach dem Holocaust eine bedeutende Rolle in der Wiener Gesellschaft spielt. Ihr kontinuierliches Engagement in der Zivilgesellschaft und die Konzentration auf Bildung und Kultur sind wesentliche Bestandteile ihrer Identität und tragen zur weiteren Stärkung der Gemeinschaft bei.
Interreligiöser Dialog in Wien
Wien hat sich als ein herausragendes Zentrum des interreligiösen Dialogs etabliert. Die jüdische Gemeinschaft ist aktiv an Diskussionen und Kooperationen mit anderen Glaubensgemeinschaften beteiligt, was zu zahlreichen Veranstaltungen und Initiativen geführt hat. Im Jahr 2000 wurde der „Tag des Judentums“ ins Leben gerufen, der am 17. Januar 2023 zum 25. Mal gefeiert wird. Dieser Tag fördert den kulturellen Austausch Wien und das gegenseitige Verständnis.
Die katholische Kirche erneuerte 1965 mit der Erklärung „Nostra Aetate“ ihr Verhältnis zum Judentum. Diese Erklärung bildete die Grundlage für umfassende Kooperationen mit anderen Glaubensgemeinschaften und führte zu einer intensiveren interreligiösen Verständigung. Bereits 1998 veröffentlichte die Evangelische Kirche A.u.H.B. in Österreich das Dokument „Zeit zur Umkehr“, um einen bewussteren Umgang mit jüdischen Traditionen zu fördern.
Die Erklärung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) im Jahr 1999 initiierte die Einführung des „Tag des Judentums“. Dieser Tag wurde später in drei Bereiche unterteilt: „Tag des Lernens“, „Tag des Gedenkens“ und „Tag des Feierns“. Beim Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit fand der „Tag des Lernens“ statt, bei dem Prof. Susanne Heine und Rabbiner Arie Folger als Hauptredner auftraten.
Rabbiner Folger hat 2016/17 eine offizielle jüdische Antwort auf die „Nostra Aetate“-Erklärung geliefert. Solche Bemühungen betonen die Bedeutung der Kooperationen mit anderen Glaubensgemeinschaften, um dem immer noch präsenten Antisemitismus entgegenzutreten. Der US-Rabbiner Joseph Ber Soloveitchik, der von 1903 bis 1993 lebte, trug ebenfalls maßgeblich zu interreligiösen Dialogen bei, die heute weiterhin Aktualität und Notwendigkeit behalten.
Zukünftige Herausforderungen und Chancen
Die jüdische Gemeinschaft in Wien steht vor bedeutenden zukünftigen Herausforderungen und Chancen, die sowohl die weitere Integration in die Gesellschaft als auch die Förderung des interkulturellen Austauschs betreffen. Durch Initiativen wie „2021. Jüdisches Leben in Deutschland“, die die 1.700-jährige Geschichte des Judentums durch diverse Veranstaltungen und Projekte aufzeigen wollen, tritt die Notwendigkeit, die jüdische Kultur und Geschichte lebendig zu halten, deutlich hervor.
Ein zentrales Problem besteht darin, dass die Geschichte des Judentums häufig auf den Kontext des Holocausts und des Antisemitismus reduziert wird. Diese einseitige Erzählweise vernachlässigt die reiche kulturelle und historische Vielfalt, die das jüdische Leben auszeichnet. Eine umfassendere Bildungsstrategie, wie sie im Rahmen des Symposiums im Oktober 2022 in der Urania in Wien angestrebt wurde, ist notwendig. Hier wurde betont, dass es eines Transformationsprozesses in den Bildungscurricula bedarf, um die jüdische Geschichte und Kultur angemessen zu vermitteln.
Der interreligiöse Dialog und interkulturelle Austausch sind entscheidende Instrumente, um Vorurteile zu bekämpfen und das Verständnis für die jüdische Kultur zu vertiefen. Veranstaltungen und Bildungsprojekte, in denen Themen wie antisemitische und fremdenfeindliche Einstellungen behandelt werden, können hier einen wesentlichen Beitrag leisten. Beispielsweise werden durch die Analyse bedeutender literarischer Werke, wie Stefan Zweigs „Eine blassblaue Frauenschrift“ und die Lyrik von Paul Celan, gesellschaftspolitisch relevante Themen beleuchtet und das Bewusstsein für historische Zusammenhänge geschärft.
Zudem spielt die Rolle der jüdischen Gemeinschaft im heutigen Wien eine wesentliche Rolle für den interkulturellen Austausch. Die lebendige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und die offene Diskussionskultur bieten große Chancen, das Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft zu stärken und ein besseres Verständnis für die jeweilige Kultur zu entwickeln. Die Förderung dieser Begegnungen und der umfassenden Bildungsinitiativen kann ein wesentlicher Schritt sein, um jüdisches Leben in Wien auch künftig zu schützen und zu bereichern.